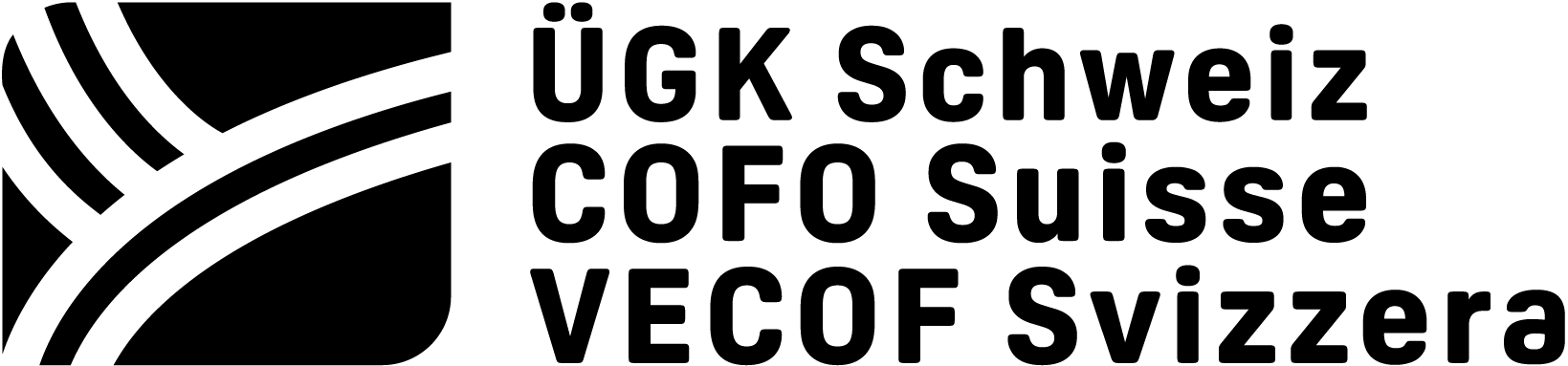ÜGK 2023
2011 haben die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren nationale Bildungsziele für vier Fachbereiche freigegeben (EDK, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d) und damit eine wichtige Grundlage für die Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Harmonisierung der Bildungsziele gemäss Art. 62 Absatz 4 der Bundesverfassung geschaffen.
Die nationalen Bildungsziele sind als Mindeststandards (Grundkompetenzen) formuliert und beschreiben, welche Kompetenzen alle Schülerinnen und Schüler in der Schulsprache, in den Fremdsprachen, in der Mathematik und in den Naturwissenschaften bis zu einer bestimmten Schulstufe erreicht haben sollen. Für die Schulsprache, Mathematik und Naturwissenschaften wurden Grundkompetenzen definiert, die bis Ende des 4., 8. und 11. Schuljahres der obligatorischen Schule zu erreichen sind. Da der Fremdsprachenunterricht in der Regel erst nach dem 4. Schuljahr einsetzt, wurden in den Fremdsprachen bis zum Ende des 8. und 11. Schuljahres zu erreichende Grundkompetenzen definiert, die (Erzinger et al., 2025).
EDK. (2011a). Grundkompetenzen für die Fremdsprachen. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96780
EDK. (2011b). Grundkompetenzen für die Mathematik. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96784
EDK. (2011c). Grundkompetenzen für die Naturwissenschaften. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96787
EDK. (2011d). Grundkompetenzen für die Schulsprache. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96791
Mit der Entwicklung gemeinsamer Bildungsziele und darauf aufbauender sprachregionaler Lehrpläne ist das Harmonisierungsziel, als solches eine Harmonisierung der Inhalte und der Anforderungen, gemäss Bildungsartikel der Bundesverfassung erreicht. Auf diesen Grundlagen war ab 2016 in der Schweiz die Einführung einer Überprüfung der Bildungsziele möglich, was eine Erweiterung des nationalen Bildungsmonitorings um ein Large-Scale-Assessment auf der nationalen Ebene mit nationalen Instrumenten zur Folge hatte: Die Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (Erzinger et al., 2025).
Das Konzept der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) wurde 2013 von der EDK-Plenarversammlung abgenommen. Die ÜGK untersucht jeweils im Rahmen des nationalen Bildungsmonitorings anhand standardisierter, digitaler Kompetenztests, verbunden mit einem Fragebogen für Schülerinnen und Schüler, schweizweit, inwieweit am Ende eines Zyklus die Grundkompetenzen erreicht werden. Dabei wird der Anteil der Schülerinnen und Schüler schweizweit und pro teilnehmendem Kanton(steil) bestimmt, der die nationalen Bildungsziele (Grundkompetenzen) erreicht. Diese Ergebnisse lassen sich als Indikator für die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme interpretieren (Erzinger et al., 2025).
Bei der ÜGK 2023 wurde das Erreichen der Grundkompetenzen in der Schulsprache (Deutsch, Französisch und Italienisch) sowie in der ersten und zweiten Fremdsprache (zweite Landessprache oder Englisch) im 11. Schuljahr HarmoS anhand standardisierter, tabletbasierter Kompetenztests überprüft.
Die Haupterhebung fand vom 17. April bis 2. Juni 2023 statt. Es beteiligten sich 25 Kantone mit einer ihre Population adäquat abbildenden Stichprobe von Schülerinnen und Schülern im 11. Schuljahr HarmoS (Bollmann & Tomasik, 2025).
Die Zielpopulation der ÜGK 2023 umfasste sämtliche Schülerinnen und Schüler, die in einer auf dem Schweizer Lehrplan beruhenden Schule im 11. Schuljahr HarmoS unterrichtet wurden. Landesweit umfasste die Zielpopulation knapp 85’000 Schülerinnen und Schüler, die in rund 1’800 Schulen unterrichtet wurden. Nach Ausschluss (für Details zu Ausschlussgründen siehe Bollmann & Tomasik, 2025) beträgt der ÜGK-Populationsumfang schweizweit 80’132 Schülerinnen und Schüler, wobei der realisierte Stichprobenumfang gesamtschweizerisch bei 18’568 Schülerinnen und Schülern lag. Es beteiligten sich 25 Kantone mit einer ihre Population adäquat abbildenden Stichprobe von Schülerinnen und Schülern (siehe Bollmann & Tomasik, 2025).
Bei der ÜGK H11 wurden drei unterschiedliche Stichprobenverfahren angewandt (Bollmann & Tomasik, 2025):
Schulzensus (BE_f, UR, SZ, OW, NW, GL, FR_f, FR_d, SO, BS, BL, SH, AR, AI, TI, VS_f, VS_d, NE, GE und JU): Hier handelt es sich um ein Stichprobenverfahren auf Schülerinnen-/Schülerebene. Es wurden alle Schulen mit einer 11. Klasse aufgeboten und innerhalb dieser wurde ein bestimmter Anteil von Schülerinnen und Schülern gezogen.
PPS-Verfahren (ZH, BE_d, LU, SG, AG und VD): Mithilfe des PPS-Verfahrens (Probability Proportional to Size) wurde hier zunächst eine systematische Schulstichprobe gezogen. In einem zweiten Schritt wurden 20 Schülerinnen und Schüler pro Schule gezogen, respektive in einer Schule mit Schülerbeständen unter 20 nahmen alle Schülerinnen und Schüler teil.
Gemischtes Design (GR und TG): Da in diesen Kantonen im Vergleich kleine Schülerinnen-/ und Schülerpopulationen in einer relativ grossen Anzahl Schulen unterrichtet werden, wurde ein gesondertes Stichprobenverfahren genutzt: Es wurden zunächst Schulen und dann die Schülerinnen und Schüler ausgewählt. Ab einer bestimmten Schulgrösse wurden aber sämtliche Schulen mit einer variierenden Anzahl Schülerinnen und Schüler getestet, während auf die Menge der kleineren Schulen ein Stichprobenverfahren angewendet wurde.
Mit der ÜGK 2023 wurde das Erreichen der Grundkompetenzen in der Schulsprache (Deutsch, Französisch und Italienisch) sowie in der ersten und zweiten Fremdsprache (zweite Landessprache oder Englisch) im 11. Schuljahr HarmoS anhand standardisierter, tabletbasierter Kompetenztests überprüft. Die Tests umfassen dabei jeweils einen Ausschnitt aus den nationalen Bildungszielen für den jeweiligen Fachbereich (EDK, 2011a, 2011d).
In der Schulsprache wurden die Kompetenzbereiche Lesen und Orthografie überprüft. Für den Kompetenzbereich Lesen sind nationale und für den Kompetenzbereich Orthografie sprachregionale Grundkompetenzen definiert. Dementsprechend wurde im Kompetenzbereich Lesen ein nationaler und im Kompetenzbereich Orthografie jeweils ein sprachregionaler Test eingesetzt. Im Kompetenzbereich Orthografie wurden in den Schulsprachen Deutsch, Französisch und Italienisch jeweils drei Dimensionen des expliziten Regelwissens überprüft (Angelone et al., 2025).
In der ersten und zweiten Fremdsprache wurden die Kompetenzbereiche Leseverstehen und Hörverstehen anhand eines breiten Spektrums an unterschiedlichen Textarten aus dem privaten, öffentlichen und ausbildungsbezogenen Umfeld der Schülerinnen und Schüler überprüft. Die getesteten Fremdsprachen sind dabei je nach Kanton und Sprachregion Deutsch, Französisch oder Englisch (Angelone et al., 2025).
Anhand der getesteten Kompetenzbereiche ergeben sich sieben Testregionen, wobei zu beachten ist, dass ein Kanton je nach Kompetenzbereich Teil von mehreren Testregionen sein kann. Die Testregionen sind: (1) Testregion Lesen in der Schulsprache, (2) Testregion Orthografie in der Schulsprache Deutsch, (3) Testregion Orthografie in der Schulsprache Französisch, (4) Testregion Orthografie in der Schulsprache Italienisch, (5) Testregion Fremdsprache Deutsch, (6) Testregion Fremdsprache Französisch und (7) Testregion Fremdsprache Englisch (Erzinger et al, 2025).
Um das anvisierte Ziel der systematischen, wissenschaftlich gestützten und auf Dauer angelegten Beschaffung, Aufbereitung und Auswertung von Informationen über das schweizerische Bildungssystem und dessen Umfeld der ÜGK zu erreichen, wurde im Rahmen der Erhebung von Grundkompetenzen über Kompetenztests hinaus eine 45-minütige Fragebogenbefragung durchgeführt.
Der Fragebogen für Schülerinnen und Schüler erfasste individuelle Merkmale bzw. Aspekte der Lernumwelt (z.B. Bildungswege, soziale Herkunft, Migrationshintergrund), Merkmale des Unterrichts bzw. didaktische Aspekte (Lehr- und Lernmethoden, Lernstrategien) sowie Lernvoraussetzungen bzw. -merkmale (Motivation, Emotionen, Selbstkonzept, Einstellungen, Wohlbefinden in der Schule, IT-Einstellungen und -Kompetenzen).
Die Planung und Durchführung übernahmen in den drei Schweizer Sprachregionen jeweils regionale Durchführungszentren. Diese stellten während der Planung der Erhebung, aber auch bei der Durchführung der Testsitzungen national standardisierte Prozesse sicher.
Die Schülerinnen und Schüler lösten Tests in der Schulsprache sowie der ersten und zweiten Fremdsprache auf Tablets. Das Equipment wurde von Testadministrierenden mit in die Schule gebracht, die darüber hinaus die Testsituation beaufsichtigten . Die Testsitzung umfasste sechs Testteile (jeweils 10-25 min.) sowie einen Schülerfragebogen (45 min.). Jeder Testteil (Schulsprache, 1. und 2. Fremdsprache) umfasste 2 Testteile und die gesamte Testsitzung dauerte 3 Stunden und 20 Minuten (inklusive mehrerer Pausen) (Arnold et al., 2025).
Folgen am 22.05.25 nach 10 Uhr
Wir möchten uns bedanken…
bei allen Schülerinnen und Schülern, welche sich auf das Abenteuer ÜGK eingelassen haben und während den Erhebungen ihr Bestes gegeben haben. Auch bei ihren Eltern und Erziehungsberechtigten bedanken wir uns herzlich für Ihr Vertrauen.
bei allen involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulen, welche im Vorfeld und während den Erhebungen zahlreiche Aufgaben erfüllt haben und damit zentrale Wegbereiterinnen und Wegbegleiter für ein gutes Gelingen der Studie waren.
bei allen involvierten Institutionen, Behörden und Kantonen für ihr Engagement im Zusammenhang mit der Realisierung und Weiterentwicklung der ÜGK sowie dem Bestreben, den Wissenstransfer und die wissenschaftliche Einbindung der Ergebnisse zu ermöglichen.
bei allen Forschenden, welche die Daten für wissenschaftliche Analysen weiterverwenden und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bildungssystems leisten.
bei allen interessierten Personen, welche sich mit dieser spannenden Thematik auseinandersetzen.
Die gute Zusammenarbeit dieser Personen ist von grosser Bedeutung für das Gelingen der Studie. Dadurch wird sichergestellt, dass die für die Schweiz gesammelten Daten von höchster Qualität sind. Wir danken Ihnen!
Die Aufgaben- und Testentwicklung, die Schwellenwertsetzung sowie die Aufbereitung der Testdaten erfolgte unter Leitung der Geschäftsstelle der Aufgabendatenbank der EDK (ADB) in Zusammenarbeit mit Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern der jeweiligen Sprachen aus allen Sprachregionen sowie mit Psychometrikerinnen und Psychmetrikern. Sie vertreten folgende Institutionen: Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), Institut für Mehrsprachigkeit (IFM) der Universität Fribourg, Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG).
Für die Planung und Organisation der Erhebungen sowie die Datenaufbereitung, die Erstberichterstattung und die Publikation der Daten war die Projektleitung ÜGK zuständig: Interfaculty Centre for Educational Research (ICER) der Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft (IfE) der Universität Zürich, Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG), Service de la recherche en éducation (SRED), Centro di innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE/DFA/SUPSI).
Die Erhebungen wurden von sprachregionalen Durchführungszentren koordiniert: in der deutschsprachigen Schweiz von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG), in der französischsprachigen Schweiz vom Service de la recherche en éducation (SRED) und in der italienischsprachigen Schweiz von dem Centro di innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE/DFA/SUPSI). Unterstützt wurden die Durchführungszentren durch die kantonalen ÜGK-Referenzpersonen.
Sämtliche erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Schweizer Datenschutzgesetz. Die Antworten auf die Testaufgaben und den Fragebogen werden mit denen aller anderen Studienteilnehmer und Studienteilnehmerinnen zusammengeführt und statistisch ausgewertet. Die Daten lassen keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen, Schüler, Eltern oder Schulen zu und keine dieser Akteure erhalten Rückmeldungen zu den Leistungen und Angaben. Die gesammelten Daten werden bei SWISSUbase, einem nationalen Forschungsdatendienst für Archivierung, Veröffentlichung und Verbreitung von Forschungs- und Metadaten (https://www.swissubase.ch/de/) pseudonymisiert und archiviert. Die Daten werden für weitere Forschungszwecke an die zuständigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übergeben. Dabei ist die Datensicherheit von zentraler Bedeutung.