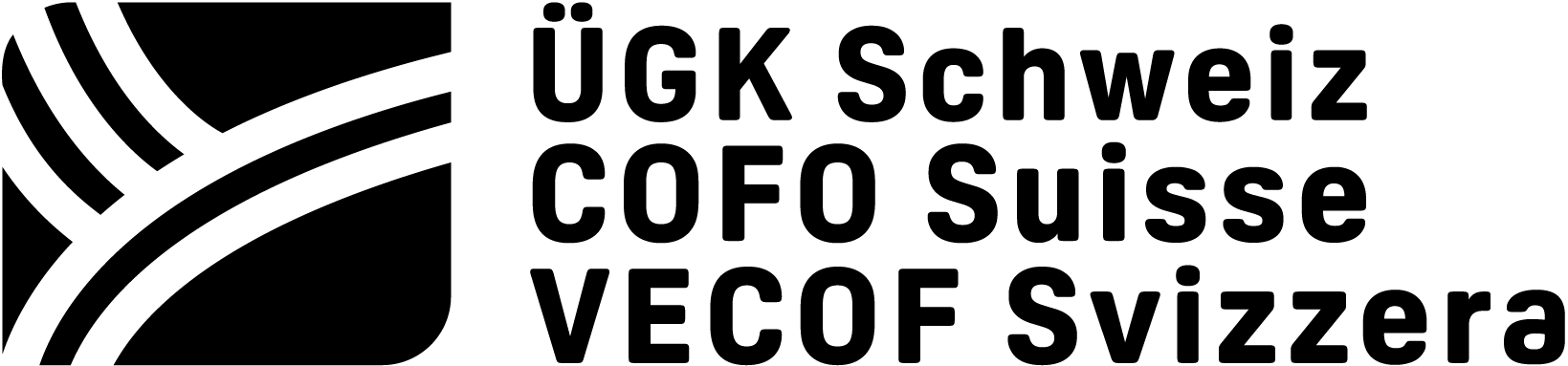ÜGK 2023

Der gesamte nationale Erstbericht der ÜGK 2023: Sprachen 11. Schuljahr findet sich hier.
Informationen zu den technischen und konzeptionellen Berichten finden sich unter «Erstberichterstattung zur ÜGK 2023» weiter unten.
2011 haben die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren nationale Bildungsziele für vier Fachbereiche freigegeben (EDK, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d) und damit eine wichtige Grundlage für die Umsetzung des Verfassungsauftrages zur Harmonisierung der Bildungsziele gemäss Art. 62 Absatz 4 der Bundesverfassung geschaffen.
Die nationalen Bildungsziele sind als Mindeststandards (Grundkompetenzen) formuliert und beschreiben, welche Kompetenzen alle Schülerinnen und Schüler in der Schulsprache, in den Fremdsprachen, in der Mathematik und in den Naturwissenschaften bis zu einer bestimmten Schulstufe erreicht haben sollen. Für die Schulsprache, Mathematik und Naturwissenschaften wurden Grundkompetenzen definiert, die bis Ende des 4., 8. und 11. Schuljahres der obligatorischen Schule zu erreichen sind. Da der Fremdsprachenunterricht in der Regel erst nach dem 4. Schuljahr einsetzt, wurden in den Fremdsprachen bis zum Ende des 8. und 11. Schuljahres zu erreichende Grundkompetenzen definiert. (Erzinger et al., 2025).
EDK. (2011a). Grundkompetenzen für die Fremdsprachen. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96780
EDK. (2011b). Grundkompetenzen für die Mathematik. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96784
EDK. (2011c). Grundkompetenzen für die Naturwissenschaften. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96787
EDK. (2011d). Grundkompetenzen für die Schulsprache. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96791
Erzinger, A. B., Angelone, D., Locher, F. M., Prosperi, O., Salvisberg, M., & Tomasik, M. J. (Hrsg.). (2025). Nationaler Bericht zu der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) 2023, Sprachen 11. Schuljahr: ein Beitrag zum Schweizer Bildungsmonitoring. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85368
Mit der Entwicklung gemeinsamer Bildungsziele und darauf aufbauender sprachregionaler Lehrpläne ist das Harmonisierungsziel, als solches eine Harmonisierung der Inhalte und der Anforderungen, gemäss Bildungsartikel der Bundesverfassung erreicht. Auf diesen Grundlagen war ab 2016 in der Schweiz die Einführung einer Überprüfung der Bildungsziele möglich, was eine Erweiterung des nationalen Bildungsmonitorings um ein Large-Scale-Assessment auf der nationalen Ebene mit nationalen Instrumenten zur Folge hatte: Die Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (Erzinger et al., 2025).
Das Konzept der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) wurde 2013 von der EDK-Plenarversammlung abgenommen. Die ÜGK untersucht jeweils im Rahmen des nationalen Bildungsmonitorings anhand standardisierter, digitaler Kompetenztests, verbunden mit einem Fragebogen für Schülerinnen und Schüler, schweizweit, inwieweit am Ende eines Zyklus die Grundkompetenzen erreicht werden. Dabei wird der Anteil der Schülerinnen und Schüler schweizweit und pro teilnehmendem Kanton(steil) bestimmt, der die nationalen Bildungsziele (Grundkompetenzen) erreicht. Diese Ergebnisse lassen sich als Indikator für die Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme interpretieren (Erzinger et al., 2025).
Erzinger, A. B., Angelone, D., Locher, F. M., Prosperi, O., Salvisberg, M., & Tomasik, M. J. (Hrsg.). (2025). Nationaler Bericht zu der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) 2023, Sprachen 11. Schuljahr: ein Beitrag zum Schweizer Bildungsmonitoring. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85368
Bei der ÜGK 2023 wurde das Erreichen der Grundkompetenzen in der Schulsprache (Deutsch, Französisch und Italienisch) sowie in der ersten und zweiten Fremdsprache (zweite Landessprache oder Englisch) im 11. Schuljahr HarmoS anhand standardisierter, tabletbasierter Kompetenztests überprüft.
Die Haupterhebung fand vom 17. April bis 2. Juni 2023 statt. Es beteiligten sich 25 Kantone mit einer ihre Population adäquat abbildenden Stichprobe von Schülerinnen und Schülern im 11. Schuljahr HarmoS (Bollmann & Tomasik, 2025).
Bollmann, S., & Tomasik, M. (2025). Stichprobendesign, Gewichtung und Varianzschätzung. ÜGK / COFO /VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Technischer Bericht. Universität Zürich. https://doi.org/10.48620/85369
Die Zielpopulation der ÜGK 2023 umfasste sämtliche Schülerinnen und Schüler, die in einer auf dem Schweizer Lehrplan beruhenden Schule im 11. Schuljahr HarmoS unterrichtet wurden. Landesweit umfasste die Zielpopulation knapp 85’000 Schülerinnen und Schüler, die in rund 1’800 Schulen unterrichtet wurden. Nach Ausschluss (für Details zu Ausschlussgründen siehe Bollmann & Tomasik, 2025) beträgt der ÜGK-Populationsumfang schweizweit 80’132 Schülerinnen und Schüler, wobei der realisierte Stichprobenumfang gesamtschweizerisch bei 18’568 Schülerinnen und Schülern lag. Es beteiligten sich 25 Kantone mit einer ihre Population adäquat abbildenden Stichprobe von Schülerinnen und Schülern (siehe Bollmann & Tomasik, 2025).
Bollmann, S. & Tomasik, M. (2025). Stichprobendesign, Gewichtung und Varianzschätzung. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Technischer Bericht. Universität Zürich. https://doi.org/10.48620/85369
Bei der ÜGK H11 wurden drei unterschiedliche Stichprobenverfahren angewandt (Bollmann & Tomasik, 2025):
Schulzensus (BE_f, UR, SZ, OW, NW, GL, FR_f, FR_d, SO, BS, BL, SH, AR, AI, TI, VS_f, VS_d, NE, GE und JU): Hier handelt es sich um ein Stichprobenverfahren auf Schülerinnen-/Schülerebene. Es wurden alle Schulen mit einer 11. Klasse aufgeboten und innerhalb dieser wurde ein bestimmter Anteil von Schülerinnen und Schülern gezogen.
PPS-Verfahren (ZH, BE_d, LU, SG, AG und VD): Mithilfe des PPS-Verfahrens (Probability Proportional to Size) wurde hier zunächst eine systematische Schulstichprobe gezogen. In einem zweiten Schritt wurden 20 Schülerinnen und Schüler pro Schule gezogen, respektive in einer Schule mit Schülerbeständen unter 20 nahmen alle Schülerinnen und Schüler teil.
Gemischtes Design (GR und TG): Da in diesen Kantonen im Vergleich kleine Schülerinnen-/ und Schülerpopulationen in einer relativ grossen Anzahl Schulen unterrichtet werden, wurde ein gesondertes Stichprobenverfahren genutzt: Es wurden zunächst Schulen und dann die Schülerinnen und Schüler ausgewählt. Ab einer bestimmten Schulgrösse wurden aber sämtliche Schulen mit einer variierenden Anzahl Schülerinnen und Schüler getestet, während auf die Menge der kleineren Schulen ein Stichprobenverfahren angewendet wurde.
Bollmann, S. & Tomasik, M. (2025). Stichprobendesign, Gewichtung und Varianzschätzung. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Technischer Bericht. Universität Zürich. https://doi.org/10.48620/85369
Mit der ÜGK 2023 wurde das Erreichen der Grundkompetenzen in der Schulsprache (Deutsch, Französisch und Italienisch) sowie in der ersten und zweiten Fremdsprache (zweite Landessprache oder Englisch) im 11. Schuljahr HarmoS anhand standardisierter, tabletbasierter Kompetenztests überprüft. Die Tests umfassen dabei jeweils einen Ausschnitt aus den nationalen Bildungszielen für den jeweiligen Fachbereich (EDK, 2011a, 2011d).
In der Schulsprache wurden die Kompetenzbereiche Lesen und Orthografie überprüft. Für den Kompetenzbereich Lesen sind nationale und für den Kompetenzbereich Orthografie sprachregionale Grundkompetenzen definiert. Dementsprechend wurde im Kompetenzbereich Lesen ein nationaler und im Kompetenzbereich Orthografie jeweils ein sprachregionaler Test eingesetzt. Im Kompetenzbereich Orthografie wurden in den Schulsprachen Deutsch, Französisch und Italienisch jeweils drei Dimensionen des expliziten Regelwissens überprüft (Angelone et al., 2025).
In der ersten und zweiten Fremdsprache wurden die Kompetenzbereiche Leseverstehen und Hörverstehen anhand eines breiten Spektrums an unterschiedlichen Textarten aus dem privaten, öffentlichen und ausbildungsbezogenen Umfeld der Schülerinnen und Schüler überprüft. Die getesteten Fremdsprachen sind dabei je nach Kanton und Sprachregion Deutsch, Französisch oder Englisch (Angelone et al., 2025).
Anhand der getesteten Kompetenzbereiche ergeben sich sieben Testregionen, wobei zu beachten ist, dass ein Kanton je nach Kompetenzbereich Teil von mehreren Testregionen sein kann. Die Testregionen sind: (1) Testregion Lesen in der Schulsprache, (2) Testregion Orthografie in der Schulsprache Deutsch, (3) Testregion Orthografie in der Schulsprache Französisch, (4) Testregion Orthografie in der Schulsprache Italienisch, (5) Testregion Fremdsprache Deutsch, (6) Testregion Fremdsprache Französisch und (7) Testregion Fremdsprache Englisch (Erzinger et al, 2025).
Angelone, D. (Hrsg.). (2025). Testentwicklung und Skalierung. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Technischer Bericht. Geschäftsstelle der Aufgabendatenbank EDK (ADB). https://doi.org/10.48620/85370
EDK. (2011a). Grundkompetenzen für die Fremdsprachen. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96780
EDK. (2011d). Grundkompetenzen für die Schulsprache. Nationale Bildungsstandards. Frei gegeben von der EDK-Plenarversammlung am 16. Juni 2011. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). https://edudoc.ch/record/96791
Erzinger, A. B., Angelone, D., Locher, F. M., Prosperi, O., Salvisberg, M., & Tomasik, M. J. (Hrsg.). (2025). Nationaler Bericht zu der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) 2023, Sprachen 11. Schuljahr: ein Beitrag zum Schweizer Bildungsmonitoring. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85368
Um das anvisierte Ziel der systematischen, wissenschaftlich gestützten und auf Dauer angelegten Beschaffung, Aufbereitung und Auswertung von Informationen über das schweizerische Bildungssystem und dessen Umfeld der ÜGK zu erreichen, wurde im Rahmen der Erhebung von Grundkompetenzen über Kompetenztests hinaus eine 45-minütige Fragebogenbefragung durchgeführt.
Der Fragebogen für Schülerinnen und Schüler erfasste individuelle Merkmale bzw. Aspekte der Lernumwelt (z. B. Bildungswege, soziale Herkunft, Migrationshintergrund), Merkmale des Unterrichts bzw. didaktische Aspekte (Lehr- und Lernmethoden, Lernstrategien) sowie Lernvoraussetzungen bzw. -merkmale (Motivation, Emotionen, Selbstkonzept, Einstellungen, Wohlbefinden in der Schule, IT-Einstellungen und -Kompetenzen; Erzinger et al., 2025).
Erzinger, A. B., Hauser, M., Pham, G., Hascher, T., Keller, R., Lenz, P., Soussi, A., & Wilhelmi, B. (2025). Kontextfragebogen für Schülerinnen und Schüler: Theoretische Einordnung. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Konzeptioneller Bericht. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85361
Die Planung und Durchführung übernahmen in den drei Schweizer Sprachregionen jeweils regionale Durchführungszentren. Diese stellten während der Planung der Erhebung, aber auch bei der Durchführung der Testsitzungen national standardisierte Prozesse sicher.
Die Schülerinnen und Schüler lösten Tests in der Schulsprache sowie der ersten und zweiten Fremdsprache auf Tablets. Das Equipment wurde von Testadministrierenden mit in die Schule gebracht, die darüber hinaus die Testsituation beaufsichtigten . Die Testsitzung umfasste sechs Testteile (jeweils 10-25 min.) sowie einen Schülerfragebogen (45 min.). Jeder Testteil (Schulsprache, 1. und 2. Fremdsprache) umfasste 2 Testteile und die gesamte Testsitzung dauerte 3 Stunden und 20 Minuten (inklusive mehrerer Pausen) (Arnold et al., 2025).
Arnold, E., Denecker, C., Locher, F., & Mazzoni, P. (2025). Study Implementation. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Languages Grade. 11. Technical Report. St.Gallen University of Teacher Education (PHSG); Educational Research Service (SRED); Centre for Innovation; Research on Education Systems (CIRSE SUPSI-DFA/ASP). https://doi.org/10.48620/85367
Schweizweit erreichen am Ende der Sekundarstufe I insgesamt 82 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen (GK) im Lesen in der Schulsprache, wobei die Anteile in den Kantonen zwischen 69 und 87 Prozent variieren. Für den Kompetenzbereich Orthografie in der Schulsprache unterscheiden sich die festgelegten Grundkompetenzen und dementsprechend auch die Testinhalte zwischen den Schulsprachen. In den Kantonen mit Deutsch als Schulsprache erreichen insgesamt 84 Prozent der Schülerinnen und Schüler (Variation zwischen den Kantonen: 79 bis 91 %). In den Kantonen mit Französisch als Schulsprache erreichen 41 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen (Variation zwischen den Kantonen: 36 bis 50 %). Im Kanton Tessin mit Italienisch als Schulsprache erreichen 77 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen in der Orthografie.
In Kantonen, in welchen die Fremdsprache Französisch unterrichtet wird, erreichen am Ende der Sekundarstufe I im Leseverstehen insgesamt 51 Prozent (Variation zwischen den Kantonen: 41 bis 66 %) und im Hörverstehen insgesamt 58 Prozent (Variation zwischen den Kantonen: 39 bis 77 %) die Grundkompetenzen. In Kantonen, in welchen die Fremdsprache Deutsch unterrichtet wird, erreichen im Leseverstehen insgesamt 52 Prozent (Variation zwischen den Kantonen: 43 bis 57 %) und im Hörverstehen insgesamt 58 Prozent (Variation auf Kantonsebene: 50 bis 66 %) die Grundkompetenzen. In Kantonen, in welchen die Fremdsprache Englisch unterrichtet wird, erreichen im Leseverstehen insgesamt 75 Prozent (Variation zwischen den Kantonen: 57 bis 86 %) und im Hörverstehen insgesamt 85 Prozent (Variation auf Kantonsebene: 61 bis 95 %) die Grundkompetenzen.
Weiter werden im nationalen Erstbericht die Anteile von Schülerinnen und Schülern, welche die Grundkompetenzen in den einzelnen Kompetenzbereichen erreichen, nach individuellen Merkmalen der Schülerinnen und Schüler beschrieben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grad des Erreichens der Grundkompetenzen sich auch nach individuellen Merkmalen der Schülerinnen und Schüler unterscheidet: Die Mädchen erreichen in allen untersuchten Kompetenzbereichen häufiger die Grundkompetenzen als die Knaben. Auch die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler steht in einem systematischen Zusammenhang mit dem Erreichen der Grundkompetenzen. Schülerinnen und Schüler im obersten Viertel der sozialen Herkunft erreichen in allen untersuchten Kompetenzbereichen deutlich öfter die Grundkompetenzen als Schülerinnen und Schüler im niedrigsten Viertel der sozialen Herkunft.
Unterschiede im Erreichen der Grundkompetenzen nach der zu Hause gesprochenen Sprache der Schülerinnen und Schüler sind bei statistischer Kontrolle des Geschlechts, der sozialen Herkunft und des Migrationshintergrunds vor allem in den beiden Kompetenzbereichen Lesen in der Schulsprache (L1) und Orthografie in der Schulsprache (L1) feststellbar. Die grössten – und auch statistisch signifikanten – Unterschiede in den beiden Kompetenzbereichen zeigen sich dabei zwischen Schülerinnen und Schülern, die zu Hause ausschliesslich die Schulsprache sprechen, und solchen, die zu Hause ausschliesslich mindestens eine andere Sprache als die Schulsprache sprechen, wobei letztere die Grundkompetenzen deutlich weniger oft erreichen.
Mit Blick auf den Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler treten bei statistischer Kontrolle des Geschlechts, der sozialen Herkunft und der zu Hause gesprochenen Sprache die grössten – und auch statistisch signifikanten – Unterschiede in den Kompetenzbereichen Lesen in der Schulsprache (L1) sowie Leseverstehen und Hörverstehen der Fremdsprache (L2/L3) Deutsch auf, wobei vor allem Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der ersten Generation im Vergleich zu solchen ohne Migrationshintergrund die Grundkompetenzen weniger oft erreichen.
Der gesamte nationale Erstbericht der ÜGK 2023: Sprachen 11. Schuljahr kann hier heruntergeladen werden.
Die Erstberichterstattung besteht aus einem nationalen Ergebnisbericht sowie folgenden im Rahmen der Erstberichterstattung veröffentlichten Dokumentationen und technischen Berichten:
Erzinger, A. B., Angelone, D., Locher, F. M., Prosperi, O., Salvisberg, M., & Tomasik, M. J. (Hrsg.). (2025). Nationaler Bericht zu der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) 2023, Sprachen 11. Schuljahr: ein Beitrag zum Schweizer Bildungsmonitoring. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85368
Der nationale Ergebnisbericht zur ÜGK 2023 umfasst die Ergebnisse zum Erreichen der Grundkompetenzen in der Schulsprache und in den Fremdsprachen. Diese werden zusätzlich nach Schultyp und individuellen Merkmalen (Geschlecht, soziale Herkunft, zu Hause gesprochene Sprache(n) und Migrationshintergrund) differenziert: berichtet. Abschliessend werden zentrale Ergebnisse der ÜGK 2023 diskutiert und Perspektiven in Bezug auf die Erforschung und Optimierung des Schweizer Bildungssystems aufgezeigt.Im Anhang werden die Ergebnisse aller an der ÜGK 2023 beteiligten Kantone bzw. Kantonsteile in kantonalen Porträts abgebildet.
Bollmann, S., & Tomasik, M. (2025). Stichprobendesign, Gewichtung und Varianzschätzung. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Technischer Bericht. Universität Zürich. https://doi.org/10.48620/85369
Der technische Bericht Stichprobendesign, Gewichtung und Varianzschätzung liefert detaillierte Informationen zum Design der Stichprobenziehung. Er beschreibt die Zielpopulation, das Vorgehen bei der Auswahl der Schul- und Schülerstichprobe sowie die Stichprobenziehung und dokumentiert die Erstellung der Stichproben- und Nonresponsegewichte. Darüber hinaus liefert der Bericht Informationen zur Berechnung der Stichprobenvarianz. Die Funktion dieses Berichts besteht darin, die Stichprobenziehung sowie die Gewichte und deren Verwendung zu dokumentieren.
Angelone, D. (Hrsg.). (2025). Testentwicklung und Skalierung. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Technischer Bericht. Geschäftsstelle der Aufgabendatenbank EDK (ADB). https://doi.org/10.48620/85370
Der technische Bericht Testentwicklung und Skalierung liefert umfassende Informationen über den Prozess der Entwicklung, Validierung und Implementierung der Testinstrumente. Er beschreibt die Schritte der Testkonstruktion, einschliesslich der Auswahl der Testaufgaben. Ausserdem erklärt er die Methoden der Skalierung, die zur Auswertung der Testergebnisse verwendet werden, und geht auf die psychometrischen Eigenschaften der Tests ein. Der Bericht soll Transparenz über die Qualität der Testaufgaben schaffen und das Testverfahren dokumentieren.
Erzinger, A. B., Hauser, M., Pham, G., Hascher, T., Keller, R., Lenz, P., Soussi, A., & Wilhelmi, B. (2025). Kontextfragebogen für Schülerinnen und Schüler: Theoretische Einordnung. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Sprachen 11. Schuljahr. Konzeptioneller Bericht. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85361
Der konzeptionelle Bericht Kontextfragebogen für Schülerinnen und Schüler: Theoretische Einordnung bietet eine detaillierte Beschreibung der theoretischen und empirischen Grundlagen der im Fragebogen verwendeten Konstrukte. Er soll allen Interessierten und den Nutzerinnen und Nutzern des Datensatzes ein tieferes Verständnis für die bei der ÜGK 2023 im Rahmen des Fragebogens für Schülerinnen und Schüler eingesetzten Messinstrumente vermitteln.
Arnold, E., Denecker, C., Locher, F., & Mazzoni, P. (2025). Study Implementation. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Languages Grade. 11. Technical Report. St.Gallen University of Teacher Education (PHSG); Educational Research Service (SRED); Centre for Innovation; Research on Education Systems (CIRSE SUPSI-DFA/ASP). https://doi.org/10.48620/85367
Der technische Bericht Study Implementation enthält detaillierte Informationen zur praktischen Durchführung der Untersuchung. Er beschreibt die Schritte der Umsetzung, einschliesslich der Organisation und Durchführung der Datenerhebung in den Schulen durch Testadministratorinnen und Testadministratoren. Der Bericht soll Transparenz über den gesamten Implementierungsprozess schaffen und die Qualitätssicherung bei der Durchführung der Studie dokumentieren.
Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Erstberichterstattung endet auch das Embargo auf den ÜGK-Daten. Der Datensatz steht Forschenden als sogenanntes Scientific Use File (SUF) auf SWISSUbase (Projektnummer 20925) zur Verfügung.
Neben weiterer Datendokumentation (z. B. Codebook oder Screenshots aller Fragen des Kontextfragebogens) wird dieser Datensatz von einem Data Manual begleitet.
Das Data Manual (Seiler & Uslu, 2025) enthält eine durch Verweise auf weiterführende Dokumentationen ergänzte Zusammenfassung der Datenerhebung sowie detaillierte Informationen zur Struktur des Datensatzes, zur Datenaufbereitung und Hinweise, die bei der Datenanalyse beachtet werden sollten. Die Beschreibung der Datenaufbereitung umfasst grundlegende Schritte der Datenbereinigung, Konventionen zur Benennung und Rekodierung von Variablen sowie Beschreibungen generierter Variablen (z. B. Indikatoren für den sozioökonomischen Status). Ziel des Data Manuals ist es, die Nachvollziehbarkeit der Datenaufbereitung sicherzustellen und den Nutzenden des Datensatzes umfassende Informationen für den Umgang mit den Daten bereitzustellen. Das Data Manual umfasst daher auch Beschreibungen und Definitionen der Variablen, die im Erstbericht für die Analysen verwendet werden, und bietet eine Starthilfe sowohl für eigenständige Analysen anderer Forschenden als auch für das Reproduzieren der Resultate in diesem Bericht.
Die auf Basis der ÜGK geschaffene Datengrundlage erlaubt eine Einordnung der Ergebnisse in einen grösseren Kontext sowie deren Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen. Deren vertiefte Analyse bietet das Potenzial, einen eigenen Beitrag zu laufenden Optimierungsprozessen von Bildungssystemen oder auch von Lehr- und Lernprozessen zu leisten (Erzinger et al., 2025).
Die Daten der ÜGK bieten den Kantonen die Möglichkeit, Vertiefungsanalysen vorzunehmen. Ferner bietet die gemeinsame Bearbeitung einer Fragestellung durch mehrere Kantone eine interessante Möglichkeit zur Beantwortung von Bildungsfragen und die Weiterentwicklung der Schweizer Bildungslandschaft. Als weiteren Punkt liefert die ÜGK eine wichtige Grundlage, um Entscheide für neue Projekte bzw. Folgeprojekte zu fällen. Die Verknüpfung der Daten der ÜGK mit externen Datenquellen bietet ebenfalls Potenzial, um Bildungsfragen zu untersuchen und die Schweizer Bildungslandschaft weiterzuentwickeln. Es besteht ebenso die Möglichkeit, nationale Administrativdaten mit den Daten der ÜGK verknüpfen zu lassen. Darüber hinaus weckt die qualitativ hochwertige Datengrundlage der ÜGK zunehmend das Interesse von Forschenden, die es sich zum Ziel gemacht haben, Bildungsforschung zu betreiben, die Lehr- und Lernprozesse in der Schweiz zu untersuchen und somit wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft zu liefern (Erzinger et al., 2025).
Erzinger, A. B., Angelone, D., Locher, F. M., Prosperi, O., Salvisberg, M., & Tomasik, M. J. (Hrsg.). (2025). Nationaler Bericht zu der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) 2023, Sprachen 11. Schuljahr: ein Beitrag zum Schweizer Bildungsmonitoring. Interfaculty Centre for Educational Research (ICER), Universität Bern. https://doi.org/10.48620/85368
Seiler, S. & Uslu, S. (editors). (2025). Data Manual. ÜGK / COFO / VECOF 2023, Languages Grade 11. Data Documentation. https://doi.org/10.48620/85366
Wir möchten uns bedanken…
bei allen Schülerinnen und Schülern, welche sich auf das Abenteuer ÜGK eingelassen haben und während den Erhebungen ihr Bestes gegeben haben. Auch bei ihren Eltern und Erziehungsberechtigten bedanken wir uns herzlich für Ihr Vertrauen.
bei allen involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schulen, welche im Vorfeld und während den Erhebungen zahlreiche Aufgaben erfüllt haben und damit zentrale Wegbereiterinnen und Wegbegleiter für ein gutes Gelingen der Studie waren.
bei allen involvierten Institutionen, Behörden und Kantonen für ihr Engagement im Zusammenhang mit der Realisierung und Weiterentwicklung der ÜGK sowie dem Bestreben, den Wissenstransfer und die wissenschaftliche Einbindung der Ergebnisse zu ermöglichen.
bei allen Forschenden, welche die Daten für wissenschaftliche Analysen weiterverwenden und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bildungssystems leisten.
bei allen interessierten Personen, welche sich mit dieser spannenden Thematik auseinandersetzen.
Die gute Zusammenarbeit dieser Personen ist von grosser Bedeutung für das Gelingen der Studie. Dadurch wird sichergestellt, dass die für die Schweiz gesammelten Daten von höchster Qualität sind. Wir danken Ihnen!
Die Aufgaben- und Testentwicklung, die Schwellenwertsetzung sowie die Aufbereitung der Testdaten erfolgte unter Leitung der Geschäftsstelle der Aufgabendatenbank der EDK (ADB) in Zusammenarbeit mit Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern der jeweiligen Sprachen aus allen Sprachregionen sowie mit Psychometrikerinnen und Psychmetrikern. Sie vertreten folgende Institutionen: Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz (PH FHNW), Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), Institut für Mehrsprachigkeit (IFM) der Universität Fribourg, Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG).
Für die Planung und Organisation der Erhebungen sowie die Datenaufbereitung, die Erstberichterstattung und die Publikation der Daten war die Projektleitung ÜGK zuständig: Interfaculty Centre for Educational Research (ICER) der Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft (IfE) der Universität Zürich, Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG), Service de la recherche en éducation (SRED), Centro di innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE/DFA/SUPSI).
Die Erhebungen wurden von sprachregionalen Durchführungszentren koordiniert: in der deutschsprachigen Schweiz von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG), in der französischsprachigen Schweiz vom Service de la recherche en éducation (SRED) und in der italienischsprachigen Schweiz von dem Centro di innovazione e ricerca sui sistemi educativi (CIRSE/DFA/SUPSI). Unterstützt wurden die Durchführungszentren durch die kantonalen ÜGK-Referenzpersonen.
Sämtliche erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Schweizer Datenschutzgesetz. Die Antworten auf die Testaufgaben und den Fragebogen werden mit denen aller anderen Studienteilnehmer und Studienteilnehmerinnen zusammengeführt und statistisch ausgewertet. Die Daten lassen keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen, Schüler, Eltern oder Schulen zu und keine dieser Akteure erhalten Rückmeldungen zu den Leistungen und Angaben. Die gesammelten Daten werden bei SWISSUbase, einem nationalen Forschungsdatendienst für Archivierung, Veröffentlichung und Verbreitung von Forschungs- und Metadaten (www.swissubase.ch) pseudonymisiert und archiviert. Die Daten werden für weitere Forschungszwecke an die zuständigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler übergeben. Dabei ist die Datensicherheit von zentraler Bedeutung.